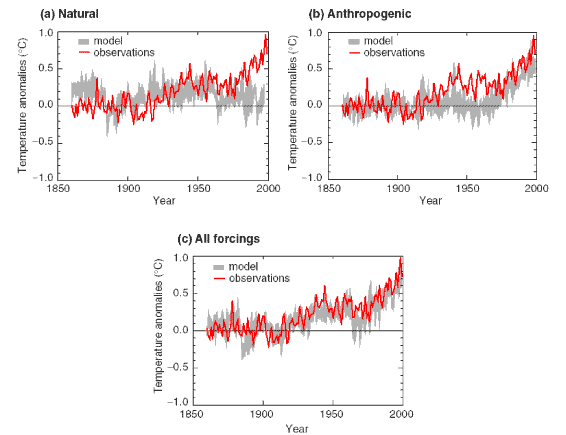Globales Klima und Treibhausgase Zu den wesentlichen Faktoren, welche die Strahlungsbilanz der Erdatmosphäre bestimmen, gehören neben der Sonnenaktivität, der Albedo der Erdatmosphäre, den Wolken, Aerosolen und Ozon, auch die sogenannten Treibhausgase. Treibhausgase sind Moleküle, die in der Lage sind, die von der Erde reflektierte Infrarot-Strahlung zu absorbieren. Die wichtigsten natürlichen Treibhausgase sind - Kohlendioxid (CO2) Treibhausgase wirken sich auf die Energiebilanz der Erde aus, indem sie, vereinfacht dargestellt, von der Sonne einfallende UV-Strahlung nicht behindern, während sie die von der Erde reflektierte langwellige Infrarot-Strahlung in der Erdatmosphäre zurückhalten. Durch diesen natürlichen Effekt wird die Erde um 33 °C wärmer (die durchschnittliche Temperatur an der Erdoberfläche beträgt +15° C, ohne den natürlichen Treibhauseffekt läge sie bei -18° C), und damit bewohnbar. Grafische Darstellung der Strahlungsbilanz, Quelle: IPCC 2001.
Als Konsequenz menschlicher Aktivitäten steigt die Konzentration all dieser natürlichen Treibhausgase- abgesehen von Wasserdampf - an. Insbesondere die Konzentration von CO2 und von Methan wurde vom Menschen drastisch erhöht. Hinzu kommen noch künstliche Gase, wie zum Beispiel teil- und vollhalogenierte Kohlenwasserstoffe HFKWs bzw. FCKWs, sowie Schwefelhexafluorid (SF6), die durch industrielle Prozesse entstehen. Dadurch kommt es zum anthropogenen Treibhauseffekt und somit zu einer verstärkten Erwärmung. Kohlendioxid entsteht vor allem durch die Verbrennung fossiler Energieträger, aber auch durch der Entwaldung der Erde, da Bäume das Treibhausgas in erheblichem Maße absorbieren und dadurch eine große Senke für Kohlendioxid bilden. Anthropogene Methanemissionen sind hauptsächlich wasserbedeckten Reisfeldern und der Viehzucht zuzuschreiben. Treibhauspotential, Radiative Forcing und Global Warming Potential Zur Charakterisierung der Auswirkungen verschiedener klimabeeinflussender Faktoren werden vorwiegend folgende Maßzahlen herangezogen: Treibhauspotential, Radiative Forcing und Global Warming Potential. Unter Treibhauspotential versteht man das Ausmaß, zu dem verschiedene Treibhausgase bei einer Erhöhung ihrer Konzentration zusätzliche Strahlungsenergie absorbieren können, was von ihren Absorptions-, Emissions- und Streuungseigenschaften abhängt. Ein Molekül Methan absorbiert beispielsweise 30 mal soviel Energie wie ein Molekül Kohlendioxid. Für die Klimawirksamkeit sind jedoch nicht nur unterschiedliche Molekülstrukturen von Bedeutung, sondern auch ihre Wechselwirkungen untereinander. Hierzu wurde das Konzept des "Radiative Forcing" entwickelt. Radiative Forcing (RF) bezeichnet die Änderung des globalen Mittels der Strahlungsbilanz an der Stratopause und ist somit ein Maß für die Störung des Gleichgewichts zwischen einstrahlender Solarenergie und an den Weltraum abgegebener langwelliger Strahlung. Ein positives "Radiative Forcing" führt zu einer Erwärmung, ein negatives zu einer Abkühlung. Als Maßeinheit werden Wm-2 verwendet. Die "Radiative Forcing"-Werte, die sich aufgrund des Anstieges der Konzentrationen an gut-durchmischten Treibhausgasen im Zeitraum von 1750 bis 2000 ergeben, werden in Summe auf 2.43 Wm-2 geschätzt. Das Konzept des Global Warming Potential (GWP) baut auf jenem des Radiative Forcing auf und umfasst die Summe aller RF-Beiträge eines Gases bis zu einem gewählten Zeithorizont, die durch die einmalige Freisetzung einer Maßeinheit am Beginn des Zeitraumes verursacht werden. Somit ist es möglich, die Klimawirksamkeit von Treibhausgasen für unterschiedliche Zeithorizonte in die Zukunft zu extrapolieren. Meist wird das Global Warming Potential bezogen auf 100 Jahre angegeben.
Natürliche und anthropogene Klimaschwankungen Das Klima war im Laufe der Erdgeschichte sehr großen Schwankungen unterworfen. Die letzen 10.000 Jahre (Holozän) waren jedoch klimatisch relativ stabil und ermöglichten so die kulturelle und intellektuelle Entwicklung des Menschen. Diese Stabilität könnte durch die jetzige rasche Erderwärmung gefährdet sein. Man geht heute davon aus, dass die im 20. Jahrhundert beobachtete Erderwärmung eine Kombination von natürlichen und anthropogenen Faktoren darstellt. Während die Erwärmung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch mit natürlichen Faktoren erklärt werden kann (Sonnenaktivität, Vulkanismus), ist die Erwärmung in der zweiten Hälfte des letzen Jahrhunderts nicht durch natürliche Faktoren alleine zu begründen. Kombiniert für diesen Zeitraum natürlichen und anthropogenen Klimafaktoren in einem Modell, kommt es zu einer sehr guten Übereinstimmung mit der beobachteten Erwärmung. (vgl. IPCC, TAR, 2001) Entwicklung der jährlichen globalen Durchschnittstemperatur, Quelle: IPCC, 2001.
Mögliches Ausmaß einer Klimaerwärmung Diese Zunahme von Treibhausgasen wurde mit dramatischen Klimaveränderungen in der Vergangenheit in Verbindung gebracht. Die augenblickliche Erhöhung der Konzentration von Treibhausgasen wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls auf das Klima auswirken, allerdings herrscht Unsicherheit in welchem Ausmaßt und in welcher Form dies stattfinden wird. Zahlreichen Wetter- und Klimadaten weisen bereit jetzt immer deutlicher auf eine Erwärmung der Erdatmosphäre hin. Man schätzt, dass die Erwärmung während des 20. Jahrhunderts etwa 0,6°C (+/-0,2°C) beträgt. (IPCC, 2001). Auch viele Beobachtungen in der Natur, wie z.B. das Abschmelzen der Gletscher oder das Ansteigen des Meeresspiegels sind zusätzliche Hinweise auf eine Erwärmung der Erde. Was die zukünftige Erderwärmung betrifft errechnen Klimamodelle einen Temperaturanstieg von 1,5°C - 4,5°C in den nächsten 100 Jahren (IPCC, 2001), doch auf Grund der eingeschränkten Rechenkapazität, sowie komplizierter Rückkoppelungseffekte im Klimakreislauf sind diese Prognosen noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Auswirkungen des Klimawandels Nach heutigem Stand der Klimaforschung gilt es als sehr wahrscheinlich, dass durch die vom Menschen verstärkte Klimaerwärmung die natürliche und menschliche Lebenswelt erheblich beeinträchtigen wird. So muss u.a. damit gerechnet werden, dass es bedingt durch das Abschmelzen der Gletscher und Eisschilde sowie der thermischen Expansion der Ozeane zu einem Anstieg des Meeresspiegels kommen wird, was die Überflutung ganzer Inselstaaten und zahlreicher tiefgelegenen Küstenregionen zur Folge haben könnte. Insbesondere in den warmen äquatorialen Klimazonen könnte es durch eine mit der Erderwärmung einhergehende Veränderung der Niederschlagsmuster zu einer zunehmenden Austrocknung und Degradation der Böden sowie zu einem spürbaren Rückgang der Nahrungsmittelproduktion und Artenvielfalt kommen. Davon werden vor allem Entwicklungsländer betroffen sein, die auch unter dem Druck anderer Einflüsse wie Bevölkerungswachstum, Rückgang der Ressourcen und Armut stehen und daher eine viel kleinere Anpassungsfähigkeit haben als Industriestaaten. Mit der Klimaerwärmung könnten ferner Tropenkrankheiten in bisher nicht betroffene Gebiete vordringen. Nicht zuletzt sagen die Klimaforscher eine Häufung extremer Wetterverhältnisse wie Wirbelstürme und Dürreperioden vorher. Adaptation and Mitigation: Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen zum Klimaschutz Ökonomische Rahmenbedingungen der Klimapolitik Die Klimapolitik ist mit der Herausforderung konfrontiert, eine möglichst hohe Reduktion an Treibhausgasemissionen kosteneffizient und sozial verträglich zu erreichen. Dazu ist es notwendig, geeignete Strategien zu entwickeln, die zu einer Stabilisierung der Treibhausgase in der Atmosphäre führen und die Kosten der Emissionsreduzierung gerecht zwischen Industrie- und Entwicklungs-ländern verteilen. Ökonomischen Instrumenten kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zu. Bezüglich der Verknüpfung von Klimawirkungen und Klimapolitik ist es notwendig, die Komplexität und Langfristigkeit des Klimawandels zu beachten. Treibhausgase sind "stock pollutants", bei denen nicht nur die jährlichen Emissionen, sondern vor allem die Einflüsse derzeitiger und vergangener Schadstoffkonzentrationen von besonderer Bedeutung sind. Aufgrund der langen Residenzzeit und der Trägheit des klimatischen Systems erfordert das "Climate Change Management" Zeithorizonte von über 100 Jahren. Der globale Charakter des Umweltproblems macht außerdem eine globale Politik und globales Agreement (vgl. United Nations Framework Convention on Climate Change) notwendig. Diese Umstände implizieren, dass die Klimapolitik als sequentieller Entscheidungs-, Lern- und Revisionsprozess verstanden werden muss, der sich eines Maßnahmenbündels bedient, das sowohl Anpassungs- als auch Minderungsstrategien umfasst. Notwendig ist daher die Anwendung einer "Doppelstrategie": Einerseits müssen die treibhausfördernden Klimagase reduziert werden, andererseits muss man sich an den voraussehbaren Klimawandel anpassen. "Anpassung und Minderung" lauten daher die Schlüsselworte, die nicht unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen. Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen zum Klimaschutz Zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen
des Klimawandels sind sowohl Minderungs- als auch Anpassungsmaßnahmen
notwendig. Die Wahl zwischen beiden Varianten ist vergleichbar mit
Entscheidungen zwischen anderen gesellschaftlichen Zielen. Als Kosten des Klimawandels bezeichnet
man Schäden durch höhere Lufttemperaturen, Meeresspiegelanstieg
sowie häufiger auftretende extreme Klimaereignisse und ihre
Auswirkungen auf natürliche und anthropogene Systeme. Die Kosten
umfassen auch höhere Risiken und Unsicherheiten, Verlust von
Leben und Ökosystemen sowie Artensterben. Minderungsmaßnahmen weisen ebenfalls
volkswirtschaftliche Nutzen und Kosten auf. Neben dem direkten Nutzen
der "Mitigation" von vermiedenen Kosten des Klimawandels
entstehen auch positive Nebeneffekte durch die Reduktion nicht-klimawirksamer
Luftverschmutzung. Große Kostenunterschiede können
allerdings zwischen einzelnen Sektoren und Ländern auftreten.
Diese Kosten können durch die Wahl von geeigneten Instrumenten
jedoch stark reduziert werden. Die Kosten-Nutzen Analyse ist eine Methode
zur Bewertung der Rentabilität staatlicher Investitionsentscheidungen,
mit deren Hilfe die gesamtwirtschaftlichen Kosten und Nutzen von
Investitionsprojekten erfasst, monetär bewertet und aggregiert
werden. Grundlegendes Ziel der KNA ist die Maximierung des menschlichen
Wohlstands. Eine andere Entscheidungshilfe stellt der Tolerable Windows Approach dar. Auf Basis definierter Rahmenbedingungen, die einerseits einen nicht tolerierbaren Klimawandel, andererseits nicht akzeptierbare Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ausschließen, soll der zulässige Handlungsspielraum mittels Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Klima und Gesellschaft ermittelt werden (vgl. Bruckner et al 2001).
Literaturtipps IPCC Forth Assessment Report JAVA Klimamodell IPCC
Third Assessment Report: Climate Change 2001
IPCC, Special
Report: "Emissions Scenarios" (2000) Climate
of 21st Century: Changes and Risks Climate Change Information Kit (UNEP) Allgemeine
Zirkulation der Atmosphäre und ihre möglichen Modifikationen
im Rahmen der globalen Klimaveränderungen © ACCC,
2008-11-01
|
||||||||||||||||
|
CO2-Rechner
Berechnen Sie Ihre mögliche CO2 -Einsparung: hier |